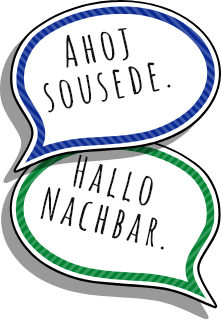Schulprojekttag an der Oberschule Adam Ries in Annaberg-Buchholz
Am 16. Mai 2025 fand an der Oberschule Adam Ries in Annaberg-Buchholz ein deutsch-tschechischer Projekttag im Rahmen des Projekts re:demo – Dialog fördern und Gemeinschaft stärken statt. Rund 40 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Tschechien arbeiteten gemeinsam zu den Themen Polarisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und interkultureller Austausch. In interaktiven Workshops diskutierten die Jugendlichen polarisierende Thesen, setzten sich mit verschiedenen Perspektiven auseinander und erprobten Formen des respektvollen Dialogs. Ziel war es, Kommunikations- und Sozialkompetenzen zu stärken und Raum für gemeinsame Erfahrungen zu schaffen – über Sprach- und Landesgrenzen hinweg. Der Projekttag wurde von Studierenden der TU Dresden und Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem gestaltet und von Lehrkräften und Projektpartnern begleitet.

Am 16. Mai 2025 fand an der Oberschule Adam Ries in Annaberg-Buchholz ein bilateraler Projekttag im Rahmen des deutsch-tschechischen Projekts re:demo – Dialog fördern und Gemeinschaft stärken / Podpora dialogu a posílení komunity statt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden, der Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, der Aktion Zivilcourage sowie der Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří durchgeführt. Im Mittelpunkt in diesem Semester stehen die Themen Polarisierung und Radikalisierung.
Der Projekttag an der Oberschule wurde von Studierenden der TU Dresden und der Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem konzipiert und durchgeführt. Begleitet und fachlich unterstützt wurden sie von Stefanie Gerstenberger (TU Dresden), Lukáš Novotný (UJEP Ústí nad Labem), Jana Wagner (Aktion Zivilcourage) und Petra Konečná (Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří) – sowie von den Lehrkräften der Schulen, die den Projekttag aktiv begleiteten.
Ziel des Projekttags war es, neben der sprachlichen und interkulturellen Verständigung auch das gesellschaftliche Bewusstsein sowie soziale und demokratische Kompetenzen der Teilnehmer:innen zu stärken. Etwa 40 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Tschechien arbeiteten an diesem Tag gemeinsam zu Fragestellungen rund um Meinungsvielfalt, Konfliktkultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der Einstieg in den Projekttag begann mit einer spielerischen Aktivität, die den deutschen und tschechischen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gab, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Um die Gruppen zu durchmischen und Berührungsängste abzubauen, starteten wir mit einer interaktiven Übung: Jede Person erhielt ein Kärtchen mit einem Begriff – auf Deutsch, Tschechisch oder Englisch. Die Aufgabe bestand darin, im Raum die beiden anderen Teilnehmer:innen zu finden, die dasselbe Wort in den jeweils anderen Sprachen hatten. Dabei kamen die Jugendlichen schnell in Kontakt, unterstützten sich gegenseitig bei der Übersetzung und tauschten erste Worte und Eindrücke aus. Die Übung schuf eine offene Atmosphäre und legte eine gute Grundlage für die weitere gemeinsame Arbeit im Verlauf des Tages.
In anschließenden Gesprächsrunden standen die kommunikativen und sozialen Kompetenzen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler lernten, in kurzer Zeit mit verschiedenen Gesprächspartnern in einen Dialog zu treten, zuzuhören und auf ihr Gegenüber einzugehen. Im Zentrum dieser Runden stand vor allem der interkulturelle Austausch: Gemeinsam sprachen die Jugendlichen über alltägliche Erfahrungen, aber auch über gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Der Schwerpunkt lag darauf, nicht nur eigene Gedanken zu teilen, sondern dem Gesprächspartner aufmerksam zu begegnen, zuzuhören, nachzufragen und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede wahrzunehmen. Ziel war es, Offenheit zu fördern, Empathie zu stärken und den Mut zu entwickeln, sich auf neue Perspektiven einzulassen.
Das zentrale Thema des Projekttags war die Polarisierung in Gesellschaft und Politik und der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen. Um sich diesem vielschichtigen Thema anzunähern, erhielten die Schülerinnen und Schüler zunächst einen kurzen theoretischen Einstieg. Daran anknüpfend fanden mehrere interaktive Workshops zu diesem Thema statt, um den Jugendlichen das Phänomen der Polarisierung verständlich zu machen und Umgangsformen damit beizubringen.
Im Positionslinienspiel setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit polarisierenden Aussagen auseinander und positionierten sich im Raum – je nachdem, ob sie einer Aussage zustimmten oder widersprachen. Von eher alltäglichen bin hin zu gesellschaftlich kontroversen Themen reichten die Thesen, zu denen die Jugendlichen Stellung bezogen. In der anschließenden Diskussion mit ihren Mitschüler:innen auf derselben oder gegenüberliegenden Seite entwickelten sie Argumente, hörten einander zu und versuchten, unterschiedliche Sichtweisen nachzuvollziehen.
An das Positionslinienspiel schloss sich eine vertiefende Übung an, bei der die Schülerinnen und Schüler sich mit einer konkreten, durchaus polarisierenden Frage auseinandersetzten: Sollte man als Einzelperson den eigenen Lebensstil einschränken, um die Umwelt zu schützen? Nachdem sie zunächst spontan ihre Meinung dazu geäußert hatten, bestand die Herausforderung darin, im nächsten Schritt die gegenteilige Position zu vertreten – unabhängig von der eigenen Überzeugung. Diese Umkehrperspektive forderte die Jugendlichen dazu auf, sich in andere Haltungen hineinzuversetzen und Argumente zu finden, die zunächst vielleicht fremd wirkten. Dabei wurde deutlich, wie sehr persönliche Erfahrungen und Werte die eigene Meinung prägen – und dass Standpunkte nicht feststehen müssen, sondern sich im Austausch verändern können. Die Übung stärkte die Fähigkeit, die eigene Perspektive kritisch zu hinterfragen, komplexe Themen differenziert zu betrachten, und förderte Offenheit für neue Sichtweisen.
Zum Abschluss des Projekttages diskutierten die Teilnehmer:innen in kleinen Gruppen über den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten im Alltag. Dabei wurde deutlich, wie entscheidend Fähigkeiten wie Toleranz, Kommunikationsfähigkeit und Empathie sind, um mit der Vielfalt an Einstellungen und Überzeugungen in unserer Gesellschaft umzugehen. Die Ergebnisse wurden gemeinsam festgehalten und reflektiert.
Der Projekttag war geprägt von einer offenen, respektvollen Atmosphäre und zeigte, wie viel Potenzial in der Zusammenarbeit von Jugendlichen aus verschiedenen sprachlichen und kulturellen Kontexten liegt. Die Schülerinnen und Schüler erweiterten ihren Wortschatz und bekamen im Austausch miteinander einen Einblick in andere Perspektiven und Denkweisen. Im Verlauf des Tages entstanden neue Kontakte, ein besseres gegenseitiges Verständnis – und die Erfahrung, dass Zusammenarbeit auch über Sprachgrenzen hinweg gut funktionieren kann.