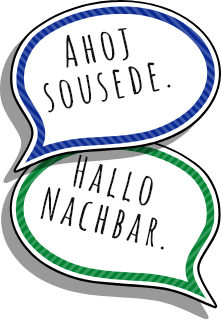Universitätsworkshop in Dresden 06.11.-08.11.2025
Vom 6. bis 8. November 2025 fand in Dresden der zweite Workshop des deutsch-tschechischen Kooperationsseminars „Demografische Dynamiken im Grenzgebiet: Herausforderungen für die Demokratie“ statt. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Projekts re:demo organisiert und brachte tschechische und deutsche Studierende zusammen, um gesellschaftliche, politische und demografische Fragestellungen aus einer interkulturellen Perspektive zu diskutieren.

Der erste Seminartag begann mit einer ausführlichen Führung durch das Gebäude des Sächsischen Landtages. Die Studierenden wurden durch verschiedene Bereiche des Hauses geleitet und erhielten dabei einen Einblick in die architektonischen Besonderheiten des modernen Parlamentsgebäudes, das bewusst transparent und offen gestaltet wurde, um demokratische Prozesse sichtbar zu machen. Ein Höhepunkt war der Besuch des Plenarsaals, in dem die Funktionsweise des parlamentarischen Alltags erläutert wurde. Die Gruppe erhielt einen Überblick über die Zusammensetzung der im Landtag vertretenen Fraktionen sowie deren Sitzordnung. Zudem wurde anschaulich erklärt, wie Plenarsitzungen ablaufen – von der Vorbereitung der Tagesordnung über Rede- und Abstimmungsprozesse bis hin zur Rolle der Präsidentin bzw. des Präsidenten während der Debatten.
Im Anschluss an die Führung kamen die Studierenden zu einem Gespräch mit den Abgeordneten Albrecht Pallas (SPD) und Ingo Flemming (CDU) zusammen. In diesem Gespräch berichteten die Politiker zunächst über ihren Alltag im politischen Betrieb und die Herausforderungen, die mit dem Amt verbunden sind. Weiterhin wurde der demografische Wandel als zentrale politische Herausforderung diskutiert. Die Abgeordneten schilderten, wie der Freistaat Sachsen mit Entwicklungen wie Überalterung, Abwanderung und Fachkräftemangel umgeht und welche politischen Maßnahmen sowie gesellschaftlichen Initiativen notwendig sind, um langfristig tragfähige Lösungen zu finden. Für die Studierenden bot dieser offene Austausch wertvolle Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und die Komplexität gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Der Abend endete mit einem gemeinsamen Abendessen, das Raum für vertiefende Gespräche bot.
Der zweite Tag startete mit einem thematischen Stadtrundgang, geführt von der Initiative „Mahngang Täter:innen-spuren“. Die Führung thematisierte historische Verantwortungsräume und erinnerungspolitische Fragestellungen in Dresden. Dabei wurden zentrale Orte der Altstadt aus einer kritischen Perspektive beleuchtet. Im Mittelpunkt stand der Hinweis, dass die barocken und touristisch bekannten Plätze nicht nur Zeugnisse der städtischen Baukunst sind, sondern auch eine dunkle Vergangenheit besitzen: Viele dieser Orte waren in der Zeit des Nationalsozialismus Schauplätze politischer Inszenierungen, Ausgrenzung und Gewalt. Dieser historische Kontext gerät in der heutigen Betrachtung der Stadt häufig in den Hintergrund oder wird bewusst ausgeblendet, weshalb die Führung einen wichtigen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit der städtischen Erinnerungskultur leistete.
Nach dem Mittagessen erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mithilfe eines Altersanzugs individuelle Erfahrungen zum Thema demografischer Wandel zu sammeln. Dieses praktische Element veranschaulichte körperliche und sensorische Veränderungen im Alter und sensibilisierte für Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. In intensiver Projektarbeit setzten die deutsch-tschechischen Gruppen vertieft weiter mit ihren Projekten auseinander. Der Tag klang mit einem interkulturellen Abend an der TU Dresden aus, der kulinarisch und sozial zur Vernetzung beitrug.
Der Samstag startet mit einem anregenden Warm-Up. Anschließend positionierten sich die Teilnehmer:innen zu Thesen, die sich auf die Grenzregion bezogen. Danach setzen die Gruppen ihre Arbeit fort. Nach dem gemeinsamen Mittagessen präsentierten die Gruppen ihren Projektfortschritt. In der anschließenden Diskussion wurden zentrale Erkenntnisse zur demografischen Entwicklung im sächsisch-tschechischen Grenzraum, zu Auswirkungen auf demokratische Teilhabe und zu Handlungsoptionen für Politik und Gesellschaft herausgearbeitet. Die Gruppenprojekte werden nun fortgesetzt und in digitalen Gallery Walks im Dezember präsentiert.
Insgesamt bot das Seminar eine gelungene Verbindung aus praktischer Erfahrung, interkultureller Zusammenarbeit und wissenschaftlicher Reflexion. Die abwechslungsreichen Formate, die Begegnungen mit politischen Akteur:innen und die grenzüberschreitende Zusammensetzung der Gruppe ermöglichten vielfältige Perspektiven auf die Frage, wie demografische Dynamiken demokratische Strukturen herausfordern – und zugleich neue Möglichkeiten für gemeinschaftliches Handeln eröffnen.