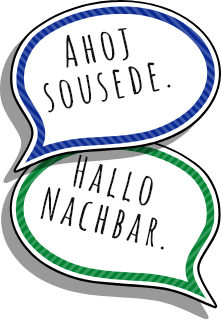Das ArchaeoTin-Projekt bei den Tagen der Landesarchäologie in Dresden. Vortrag von Dr. Manfred Böhme
Bei den diesjährigen Tagen der Landesarchäologie konnten vom 29. bis 30. November über 400 Teilnehmer begrüßt werden. Diese konnten durch insgesamt 23 Fachvorträgen einen Überblick zu den Arbeiten und Aufgaben der sächsischen Landesarchäologie im vergangenen Jahr erhalten. Das ArchaeoTin-Projekt war mit gleich zwei Vorträgen vertreten, in denen erste Forschungsergebnisse vorgestellt wurden.

Untersuchungen des ArchaeoTin-Projektes in der Pilotregion Ehrenfriedersdorf, Greifenbachtal.
Der Vortrag von Manfred Böhme, Landesamt für Archäologie Dresden (Leadpartner) umfasste seine bisherigen Untersuchungen im
Greifenbachtal zwischen Ehrenfriedersdorf und Geyer, die eine von den drei Pilotregionen des ArchaeoTin-Projektes auf sächsischer Seite ist. Die bergmännische Gewinnung von Zinnerz dauerte im dortigen Revier bis 1990 an. Die Anfänge liegen im Spätmittelalter und betreffen vor allem den Abbau in offenen Gruben, den Zinnseifen. M. Böhme stellte in seinem Vortrag vor, wie die Hinterlassenschaften der Seifentätigkeiten im Greifenbachtal aussehen und wie diese auch mit Fernerkundung durch Luftbilder und digitaler Geländemodelle erkannt und typologisch geordnet werden können. Anhand recht genauer Datierungen der Bergbauaktivitäten mittels C14-Analysen sind bisher bestehende Vermutungen zur chronologischen Abfolge zu korrigieren. Ein Seifenareal wurde spätestens im 13., möglicherweise bereits im 12. Jahrhundert angegangen. Das benötige Wasser leitete man über Kunstgräben herbei, womit deren ursprüngliche Funktion noch nicht für den Maschinenantrieb in den Bergwerken gedacht war.
Die Eingriffe durch das Montanwesen in den Naturhaushalt lassen sich gut durch „umgewühlte“ Seifenhalden nachvollziehen. Wie sich Bergbau auswirken kann, zeigte sich an mächtigen Schichten aus erodiertem Bodenmaterial, welches sich an anderer Stelle des Greifenbaches abgesetzt hatte. Die darin eingebetteten Funde, wie Keramik, Holzkohlen und metallurgische Schlacken, lassen bergbauliche Aktivitäten am oberen Greifenbach ab dem 12. Jahrhundert nachvollziehbar erkennen. In dem Areal muss mit Pochwerken und Hütten mit Schmelzöfen gerechnet werden, die bisher jedoch unbekannt und noch nicht lokalisiert wurden.