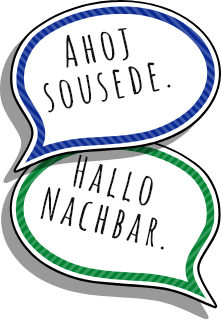Die palynologische Forschung im Labor beim Projektpartner, Institut für vor- und frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität, München geht weiter

Die erste Aufgabe war die Entnahme der Bohrkerne aus ausgewählten Mooren im sächsischen Erzgebirge. Dafür wurden Probebohrungen durchgeführt, um die tiefste Stelle zu finden. In unserem Fall waren dies das Moor bei Schellerhau, der kleine Kranichsee und das Georgenfelder Hochmoor. Mit Hilfe der Dachnowski Sonde wurden die Bodenkerne entnommen, welche jeweils 0,5m lang sind. Die Kerne wurden vor Kontaminierung geschützt, ins Labor gebracht und bis zur entsprechenden Labor-Analyse eingefroren.
Im Labor findet zur Zeit der zweite Teil der Arbeiten statt und zwar die Pollenanalyse. Dabei haben wir aus den Kernen Proben abgeschnitten, welche 0,5-2 cm3 groß sind. Diese haben wir in Erlenmeyerkolben mit 10% Salzsäure (HCl) und Lycopodium-Tabletten hinzugefügt bis sie miteinander reagieren haben. Dieser Prozess wurde durch Schütteln beschleunigt. Im Anschluss wurden die Proben für 20-30 Minuten in ein kochendes Wasserbad gelegt. Die Proben wurden dann zentrifugiert und mit aqua destilla bis zu drei Mal gewaschen. Daraufhin wurde das destillierte Wasser abzentrifugiert, Kalilauge (KOH) hinzugefügt und die Proben wieder in kochendes Wasser gegeben. Nachdem sie nochmals abgewaschen und zentrifugiert wurden, fügt man 100% Eisessigsäure (CH3COOH) hinzu und lässt es für eine Stunde reagieren. Die Säure wurde dekantiert und man fängt mit der Acetolyse an. Bei der Acetolyse wird Essigsäureanhydrid (C4H6O3) und Schwefelsäure (H2SO4) im Verhältnis von 9 zu 1 gemischt, dieses wird in den Reagenzgläsern mit den Proben hinzugefügt und gekocht. Dieser Prozess findet statt, damit die Cellulose und andere Polysacharide entfernt werden. Anschließend werden die Proben solange gewaschen bis sie klar und geruchsneutral sind, dann dekantiert und Glycerin hinzugefügt.
Zuletzt findet die mikroskopische Auswertung der Pollen statt. Dabei werden die Pollen unter dem Mikroskop bestimmt, deren Häufigkeit berechnet und die Ergebnisse interpretiert. Dadurch kann man das Klima, die Vegetation und somit auch den menschlichen Einfluss auf die Natur rekonstruieren.